Was versteht man unter Konsumentenethik (Konsumethik, Verbraucherethik)?
Welche Beispiele aktueller Themen der Konsumentenethik gibt es? Wie groß ist die Macht der Konsumenten (Verbraucher)? Welche Rolle spielt eine Konsumethik/Verbraucherethik bei der Bewältigung der Umweltkrise?
Definition und Aufgaben
Die Konsumentenethik, ein Teilbereich der Wirtschaftsethik, untersucht aus ethischer Perspektive die Auswirkungen von Kauf- und Konsumentscheidungen auf ökologische Aspekte, das Tierwohl und Belange der sozialen, globalen und intergenerativen Gerechtigkeit.[1]
Dabei betrachtet sie Entscheidungen, die Konsumenten beim Einkaufen und Konsumieren von Produkten und Dienstleistungen oder bei einem Konsumverzicht treffen.
Der Begriff „Konsumentenethik“ setzt sich aus den Wörtern „Konsumenten“ (von lateinisch „consumere“ für „verbrauchen“) und „Ethik“ (von griechisch „ethos“ für „Sitte, Charakter“) zusammen.[2]
Die Ethik, seit Aristoteles eine eigenständige philosophische Disziplin, ist von der Idee eines sinnvollen menschlichen Lebens geleitet und sucht nach allgemeingültigen Aussagen über das gerechte und gute Handeln.[3]
Ausgehend von dieser Definition sucht die Konsumentenethik nach allgemeingültigen Aussagen über ein sinnvolles Konsumverhalten sowie das gerechte und gute Handeln von Konsumenten.
Angesichts der zahlreichen Krisen in den Bereichen Naturschutz, Umweltschutz, Tierschutz, Generationengerechtigkeit oder sozialer und globaler Gerechtigkeit kann die Konsumentenethik im 21. Jahrhundert einen wertvollen Beitrag zur Bewältigung dieser Krisen leisten.
Merkmale deskriptiver und normativer Ansätze
In der Konsumentenethik kann zwischen einem deskriptiven und einem normativen Ansatz unterschieden werden. Diese Ansätze weisen folgende Merkmale auf:
Die deskriptive Konsumentenethik untersucht aus einer beschreibenden Perspektive, wie sich Konsumenten in einem Wirtschaftssystem ethisch real verhalten.
Sie analysiert vergangenheits- und gegenwartsbezogen anhand systematischer Beobachtungen, welche Handlungen und Werte von Konsumenten als gut und richtig erachtet wurden und werden, ohne diese zu bewerten.
Hierzu kann sich die Konsumentenethik interdisziplinär verschiedener Methoden aus der Statistik, der Psychologie, der Ökologie, der Soziologie und der empirischen wirtschaftswissenschaftlichen Forschung bedienen.
So kann beispielsweise das Konsumverhalten in Bezug auf folgende Aspekte ethisch untersucht werden:
- Welche Produkte und Dienstleistungen nutzen Konsumenten?
- Welche Auswirkungen hat diese Nutzung auf die Natur, die Umwelt, das Tierwohl oder andere Menschen?
- Wie häufig und wie lange nutzen Konsumenten bestimmte Produkte und Dienstleistungen?
- Aus welchen Gründen nutzen Konsumenten bestimmte Produkte und Dienstleistungen?
- Verzichten Konsumenten freiwillig auf den Konsum bestimmter Produkte und Dienstleistungen?
- Falls ja, aus welchen Gründen leisten Konsumenten diesen Konsumverzicht und bevorzugen sie stattdessen Güter, die höheren ethischen Anforderungen genügen?
Die normative Konsumentenethik untersucht und formuliert aus einer richtungsweisenden Perspektive ethische Prinzipien, die das Konsumverhalten bestimmen und leiten sollten. Ihr Ziel ist es, ethischen Konsum zu fördern und zu ermöglichen.
Sie definiert gegenwarts- und zukunftsbezogen, welche Handlungen, Werte und Ziele Konsumenten als gut und richtig innerhalb eines Wirtschaftssystems erachten können – und letztlich sollten.
Dabei kann sie auf die gewonnenen Erkenntnisse der deskriptiven Konsumentenethik zurückgreifen.
Zentrale Fragen
Eine praktisch angewandte Konsumentenethik befasst sich mit folgenden zentralen Fragen:
- Sollten sich Konsumenten aktiv an der Gestaltung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen unter ethischen Gesichtspunkten beteiligen?
- Sollten Konsumenten freiwillig höhere ethische Standards als die gesetzlich vorgeschriebenen einhalten, auch wenn dies möglicherweise einen geringeren Gewinn und Nutzen oder einen Verzicht bedeutet?
- Sollten sich Konsumenten ausschließlich auf die Maximierung ihres Gewinns oder Nutzens innerhalb der bestehenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen konzentrieren?
Die letzte Frage legt den Schwerpunkt der Konsumentenethik auf die Wirtschaftsordnung und nicht auf die Konsumenten selbst. Dieser Ansatz kann wie folgt definiert werden:
„Der systematische Ort der Moral in der Marktwirtschaft ist die Rahmenordnung“.[4]
(Dr. Karl Homann, emeritierter Professor des Lehrstuhls Philosophie, Politik und Wirtschaft an der LMU München)
Als Disziplin überprüft die Konsumentenethik demnach auch bestehende staatliche Regelungen und hinterfragt Regelungslücken in der geltenden wirtschaftlichen Rahmenordnung.
Im Wesentlichen bewegt sich die Konsumentenethik im Spannungsfeld zwischen Individualethik (welche Rolle spielen ethisch relevante Entscheidungen einzelner Konsumenten?) und Ordnungsethik (wie lassen sich ethische Regeln in eine Gesellschaft integrieren?).
Beispiele aktueller Themen
Obwohl bereits viele Länder weltweit in ihren Rahmenordnungen der Wirtschaft den Naturschutz, Umweltschutz und Tierschutz berücksichtigen, besteht dennoch erheblicher Handlungsbedarf.[5]
Konsumenten können durch ihre Kaufentscheidungen bestehende Regelungslücken schließen. Im Folgenden werden aktuelle Beispiele und Themen der Konsumentenethik aus den Bereichen Naturschutz, Umweltschutz, Tierschutz und fairem Handel vorgestellt und Handlungsmöglichkeiten verdeutlicht.
Naturschutz und Umweltschutz
Die folgenden vier aktuellen Beispiele zeigen, wie eine angewandte Konsumentenethik den Naturschutz und Umweltschutz verbessern kann:
- Plastikmüll in den Weltmeeren
Handlungsoption für ethischen Konsum: Vermeidung von Plastik beim Einkauf, sowohl bei den Produkten selbst als auch bei deren Verpackungen.
- Chemikalien im Grundwasser
Handlungsoptionen für ethischen Konsum: Einkauf nachhaltig und biologisch hergestellter Produkte, Bekämpfung unerwünschter Pflanzen und Schädlinge im Garten mit natürlichen und biologischen Methoden, Verwendung ökologisch ausgerichteter Putzmittel, Waschmittel und Kosmetika im Haushalt.
- Abholzung tropischer Regenwälder
Konsumentenentscheidung: Konsumverzicht auf Produkte aus tropischen Regenwäldern.
- Artensterben von Pflanzen und Tieren
Handlungsoptionen für Konsumenten mit eigenem Garten: Anlegen eines Naturgartens mit einheimischen Pflanzen zum Schutz einheimischer Tierarten wie Insekten (Bienen, Schmetterlinge), Igeln und Vögeln sowie Verwendung natürlicher und biologischer Mittel zur Pflanzenpflege.
Tierschutz
Die folgenden zwei aktuellen Beispiele zeigen, wie eine angewandte Konsumentenethik den Tierschutz verbessern kann:
- Tierexperimente und Tierversuche
Handlungsoption für Konsumenten: Konsumverzicht auf Produkte, die an Tieren getestet wurden.
- Massentierhaltung und Tiertransporte
Handlungsoption für ethischen Konsum: Bevorzugung regionaler Bio-Produkte aus Freilandhaltung.
Fairer Handel
Im globalisierten Handel kann eine angewandte Konsumentenethik zu einem fairen Handel zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern beitragen.
Der „Faire Handel“ (englisch: Fair Trade, Fairtrade) verfolgt das Ziel, Tauschgerechtigkeit beim Import von Produkten aus Afrika, Asien oder Südamerika zu gewährleisten.
Diese Tauschgerechtigkeit kann beispielsweise durch die Einhaltung folgender Sozialstandards und Umweltstandards in den produzierenden Ländern des Globalen Südens realisiert werden:
- Güterproduzenten erhalten in der gesamten Lieferkette einen sicheren, gerechten Mindestpreis.
- Mitarbeiter in Produktionsunternehmen erhalten gerechte Löhne.
- Sicherstellung sozialer Standards für die Mitarbeiter, wie Schutz bei Krankheit und Kündigung.
- Sichere körperliche Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter, wie Schutz vor Vergiftung und Verletzung.
- Ausschluss von Kinderarbeit und Jugendarbeit.
- Umweltfreundliche Produktionsmethoden zum Schutz der Böden, des Grundwassers und der Luft.
Konsumenten können diese Ziele unterstützen, indem sie bei ihrem Einkauf Produkte mit einer Fair-Trade-Kennzeichnung bevorzugen.
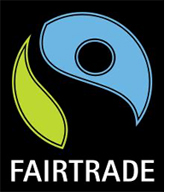
Auf diese Weise fördern sie soziale Gerechtigkeit, Naturschutz und Umweltschutz in den Entwicklungsländern.
Fairtrade International ist das weltweit größte Sozialsiegel für fairen Handel. Es setzt sich für gerechtere Bedingungen für die Menschen im Globalen Süden ein, die Lebensmittel für Industrieländer anbauen oder Rohstoffe abbauen.
Fairtrade-Lebensmittel umfassen eine Vielzahl von Produkten, darunter Früchte, Gewürze, Honig, Kaffee, Kakao, Quinoa, Reis, Säfte, Schokolade, Sirup, Tee, Trockenfrüchte, Wein oder Zucker.
Ferner zählen dazu Rohstoffe wie Gold und Silber sowie Pflanzenprodukte wie Baumwolle und Blumen.
Ethischer Konsum und ethischer Konsumverzicht
Konsumenten können ethisches Verhalten durch ethischen Konsum oder ethischen Konsumverzicht auf bestimmte Produkte oder Dienstleistungen zum Ausdruck bringen.
Auch die Häufigkeit von Einkäufen und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen spielen eine Rolle.
Darüber hinaus können Konsumenten ethischen Konsum durch die Art und Weise und Häufigkeit der Nutzung gekaufter Produkte sowie durch deren Entsorgung zum Ausdruck bringen.
Die Idee, dass wir nicht nur für unsere Handlungen, sondern auch für unsere Unterlassungen verantwortlich sind, wird entweder dem französischen Dichter Molière (1622–1673) oder dem chinesischen Philosophen Laotse (Laozi) zugeschrieben, der im 6. Jahrhundert vor Christus gelebt haben soll.
Dieser Ansatz, dass wir nicht nur für das verantwortlich sind, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun, ist auch auf die Konsumentenverantwortung übertragbar.
Demnach handeln Konsumenten nicht automatisch ethisch, nur weil sie sich an die geltenden Regeln der Rahmenordnung der Wirtschaft halten. Sie können diese Regeln auch hinterfragen.
Ethischer Konsum und ethischer Konsumverzicht zeigen sich erst in Bezug auf die geltenden gesetzlichen Vorgaben. Sei es, dass Konsumenten sie freiwillig übererfüllen oder nicht ausschöpfen.
Wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen beispielsweise Naturzerstörung, Tierversuche oder soziale Ausbeutung bei der Produktion und in nachgelagerten Lieferketten zulassen, können sich Konsumenten dazu entschließen, diesen Spielraum bei ihren Konsumentscheidungen nicht auszuschöpfen.
Erst dieses bewusste Handeln oder dieser Verzicht verleiht dem Konsum eine ethische Dimension.
Ethischer Konsum bedeutet beispielsweise, bewusst ökologisch nachhaltige Produkte zu wählen, auch wenn diese teurer sind oder geringere Gebrauchseigenschaften aufweisen als konventionell hergestellte Produkte.
Ethischer Konsumverzicht bedeutet beispielsweise, auf den Kauf von Produkten und Dienstleistungen auf der Basis von Tierversuchen zu verzichten, auch wenn sie durch gesetzliche Vorgaben erlaubt sind.
Konsumentensouveränität versus Produzentensouveränität
Die praktische Bedeutung der Konsumentenethik wird in zwei kontrovers diskutierten Ansätzen hinterfragt: dem Ansatz der Konsumentensouveränität (Verbrauchersouveränität) und dem Ansatz der Produzentensouveränität.
Hintergrund dieser Ansätze ist die Frage, wer letztlich den größeren Einfluss auf Konsumentscheidungen hat: die Nachfrager oder die Anbieter von Produkten.
Die Meinungen reichen dabei von der Annahme rational handelnder, souveräner Konsumenten bis hin zur Vorstellung, dass Unternehmen die Bedürfnisse der Konsumenten vollständig manipulieren können.
Die These der Konsumentensouveränität (Verbrauchersouveränität) geht davon aus, dass individuelle und freie Entscheidungen von mündigen und gut informierten Konsumenten das Angebot von Waren und Dienstleistungen so steuern, dass dem Allgemeininteresse am besten gedient wird.[6]
Die These der Produzentensouveränität geht hingegen davon aus, dass Unternehmen die Bedürfnisse und die Nachfrage der Konsumenten so beeinflussen können, dass diese dieser Manipulation mehr oder weniger hilflos ausgeliefert sind.[7]
Beide Definitionen werfen grundlegende Fragen auf:
- Werden die Konsumenten als rational oder irrational handelnde Wesen betrachtet?
- Welchen Einfluss haben Unternehmen auf die Bedürfnisse von Konsumenten?
- In welchem Umfang können Unternehmen durch Marketing und Werbung die Nachfrage nach ihren Produkten beeinflussen, um ihren Absatz und Gewinn zu steigern?
Da keine der beiden gänzlich konträren Thesen uneingeschränkt gelten kann, liegt die Wahrheit – wie so oft in einem solchen Fall – wahrscheinlich zwischen ihnen.
Marktwirtschaftliche Auswirkungen der Kaufentscheidung und des Kaufverzichts
Die Auswirkungen ethischer Entscheidungen von Konsumenten, auf den Kauf bestimmter Produkte oder die Inanspruchnahme von bestimmten Dienstleistungen freiwillig zu verzichten oder nicht, sind in einer Marktwirtschaft erheblich:
Unternehmen passen beispielsweise ihre Produktionsweise, Lieferketten und Produktangebote an, um den Erwartungen von ethisch motivierten Konsumenten gerecht werden zu können.
Märkte verändern sich, indem beispielsweise nachhaltige, umweltfreundliche, tierfreundliche oder global und sozial faire Produkte an Bedeutung gewinnen und Wettbewerbsstrategien neu ausgerichtet werden.
Konsumenten mit einer universell ausgerichteten Konsumentenethik können verschiedene Belange berücksichtigen, wie zum Beispiel den Naturschutz, Umweltschutz und Tierschutz oder soziale, globale und intergenerative Gerechtigkeit.
Daraus resultierende Konsum- und Kaufentscheidungen, sowohl im Einzelhandel als auch in Online-Bezahlsystemen, spielen eine entscheidende Rolle, welche Produkte auf dem Markt angeboten werden und welche nicht.
Wenn Konsumenten weltweit beispielsweise nicht laufend eine Vielzahl von Produkten an vielen Orten nachfragen, werden diese auch nicht laufend an viele Orte der Welt transportiert.
Die folgenden Beispiele aus dem Bereich des Natur- und Umweltschutzes verdeutlichen das Spektrum der Auswirkungen einer Kaufentscheidung oder eines eines Kaufverzichts auf das Angebot verschiedener Produkte:
- Wenn Konsumenten hochwertige und langlebige Produkte bevorzugen, werden minderwertige und kurzlebige Produkte, die einem schnellen Verschleiß unterliegen, immer weniger angeboten.
- Wenn Konsumenten wiederverwendbare und recycelbare Produkte bevorzugen, werden Wegwerfprodukte und nicht recycelbare Produkte immer weniger angeboten.
- Wenn Konsumenten Produkte bevorzugen, die bei der Produktion, Lieferung und Nutzung einen geringen Energiebedarf und Rohstoffverbrauch erfordern, passt sich das Konsumgüterangebot ihren Wünschen an.
- Wenn Konsumenten beispielsweise in Europa weniger Äpfel aus dem 18.000 km entfernten Neuseeland kaufen, verringert sich das Angebot von neuseeländischen Äpfeln in Europa.
- Wenn Konsumenten beispielsweise in Europa weniger Schnittblumen aus dem 9.000 km entfernten Kolumbien kaufen, verringert sich das Angebot von kolumbianischen Schnittblumen in Europa.
- Wenn Konsumenten weniger exotisches Obst- und Gemüse kaufen, verringert sich deren Angebot.
Würde sich die mit dem Transport von Produkten verbundene Belastung der Natur in höheren Preisen ausdrücken, würde Konsumenten der Luxus mancher Produkte, die sie konsumieren, bewusster werden.
Wer überall und jederzeit alle Produkte konsumiert und nachfragt, setzt damit ein Signal am Markt.
Wünschenswert wäre daher, dass sich die Konsumenten ihrer Mitverantwortung für den Transportwahnsinn, der täglich weltweit stattfindet, bewusster werden und ihre Kaufentscheidungen bewusster treffen.
Ein ähnlicher Zusammenhang besteht auch im Bereich des Tierschutzes und des Tierwohls:
- Wenn Konsumenten keine Produkte kaufen, die ohne gesetzliche Verpflichtung mit Tierversuchen entwickelt wurden, werden diese auch nicht mehr angeboten und tierversuchsfreie Produkte setzen sich durch.
- Wenn Konsumenten keine tierischen Produkte kaufen, die aus Massentierhaltung und unwürdigen Tiertransporte stammen, werden diese auch nicht mehr angeboten.
Bedeutung für die Bewältigung der Krisen im 21. Jahrhundert
Wie im vorherigen Kapitel erläutert, ist es in einer Marktwirtschaft von entscheidender Bedeutung, ob sich für bestimmte Produkte Abnehmer und Käufer finden lassen.
Nur dann werden Produkte, die dem Tierwohl, der Natur, der Umwelt oder sozialer, globaler und intergenerativer Gerechtigkeit zugutekommen, auch produziert und transportiert.
Darüber hinaus spielt die Bereitschaft von Konsumenten, freiwillig Geld für nachhaltigen und ethischen Konsum auszugeben, eine entscheidende Rolle für das Ausmaß, in dem Hersteller und Anbieter entsprechender Produkte mit Vermarktungsproblemen konfrontiert sind.
Daher haben die Kaufentscheidungen von Konsumenten an der Ladenkasse oder in Online-Bezahlsystemen eine Schlüsselfunktion bei der Förderung von Umweltschutz, Naturschutz, Tierschutz sowie sozialer, globaler und intergenerativer Gerechtigkeit im 21. Jahrhundert.
Dies verleiht der Konsumentenethik das Potential, maßgeblich zur Bewältigung dieser Krisen beizutragen, da sie die vielversprechendste Option zu sein scheint, um unbürokratisch und einfach schnelle Fortschritte bei der Bewältigung dieser Krisen zu erreichen.
Es erschließt sich marktwirtschaftlich von selbst, dass Produkte, die nicht gekauft werden, auch nicht angeboten werden und daher nicht zu Lasten der Natur, der Umwelt und des Tierwohls hergestellt und nach der Nutzung entsorgt werden können.
Die täglichen Entscheidungen von Konsumenten an der Ladenkasse und in Online-Bezahlsystemen können frei von gesetzlichen Vorschriften verändert werden.
Erheblich aufwendiger und langwieriger erscheint dagegen die Umstellung von Produktionsmethoden und des Sortiments von Unternehmen sowie die Etablierung nationaler Regelungen und internationaler Abkommen zur Verbesserung des Naturschutzes, Umweltschutzes und Tierschutzes.
Die potentielle Bedeutung und die Voraussetzungen für den Erfolg einer integrierten Konsumentenethik als Teilgebiet der Umweltethik werden ausführlicher in einem separaten Kapitel erläutert.
Die Macht der Konsumenten bei der Shell-Bohrinsel Brent Spar
Eine alltägliche Konsumentscheidung, wie das Tanken, eignet sich als Fallbeispiel für die Macht der Konsumenten. Im Jahr 1995 boykottierten deutsche Autofahrer die Tankstellen des Mineralölkonzerns Shell.
Dieser Boykott war eine Reaktion auf den massiven Protest der Umweltorganisation Greenpeace gegen die von Shell> geplante Versenkung ihrer ausrangierten Bohrinsel Brent Spar in der Nordsee.
Der Protest von Greenpeace wurde durch eine bis dahin beispiellose Medienkampagne unterstützt, die in der deutschen Bevölkerung eine Welle der Entrüstung auslöste.
Doch erst der gezielte Boykott des Tankstellennetzes veranlasste Shell im Juni 1995 dazu, von einer Versenkung der Brent Spar abzusehen, um weitere Umsatzeinbrüche zu vermeiden.
Das Motto „Alle Macht den Konsumenten“ war erfolgreich erwiesen und eine Sensation war geschaffen:
Die Brent Spar wurde zu einem Symbol für die Ausbeutung der Meere und den wirkungsvollen Protest von Konsumenten durch eine gemeinschaftliche Konsumentscheidung.
Darüber hinaus schuf die Brent Spar einen Präzedenzfall für ökologische Verantwortung.
Sie warf die Frage auf, was mit den anderen 416 Öl-Bohrinseln in der Nordsee geschehen sollte, die seinerzeit in Betrieb waren und von denen in den folgenden zehn Jahren 75 zur Entsorgung anstanden.[8]
Auf der vierten Nordseeschutz-Konferenz im Juni 1995 sprachen sich die Minister der beteiligten Staaten mehrheitlich dafür aus, dass zukünftig alle ausgedienten Öl-Bohrinseln, selbst nach der Entfernung von Giftstoffen, auf dem Festland zu entsorgen sind.[9]
Ein generelles Versenkungsverbot für Öl-Bohrinseln in der Nordsee scheiterte am Widerstand von Norwegen und Großbritannien, die sich trotz der ökologischen Risiken eine Entscheidung im Einzelfall vorbehielten.[10]
Dennoch regte die Brent Spar eine umweltethische Diskussion darüber an, ob das Meer als Müllkippe für Industrieschrott, Ölrückstände, Schwermetalle und schwach radioaktive Substanzen verwendet werden darf.[11]
Es wurde die Frage aufgeworfen, ob sich die langfristigen Konsequenzen einer Versenkung dieser Materialien und Umweltgifte in der Nordsee mit einer nachhaltigen Entwicklung vereinbaren lassen:
Ein ökologischer Niedergang der Weltmeere hätte verhängnisvolle Folgen für Menschen, Tiere und die Natur, da die Weltmeere global die Hälfte des Sauerstoffs produzieren.[12]
Es bleibt abzuwarten, ob die Konsumenten ihre Macht auch zukünftig bei alltäglichen Konsumentscheidungen wie dem Einkaufen nutzen werden. Dies könnte zu weiteren Vermarktungsproblemen von umweltunfreundlichen Produkten führen.
Eine solche Revolution im Konsumverhalten könnte erheblich zur Milderung der Umweltkrise beitragen.
Abgrenzung zur Wirtschaftsethik
Die Wirtschaftsethik untersucht beschreibend (deskriptiv) die in der Praxis verbindlich akzeptierten Werte in der Wirtschaft und normsetzend (normativ) die moralischen Normen, die in der Wirtschaft eingeführt werden sollten.
Einfach ausgedrückt, untersucht die Wirtschaftsethik, welche Werte in der Wirtschaft in Wirklichkeit wirklich gelten und welche Werte idealerweise gelten sollten.
Ihr Ziel ist es, einen Ausgleich zwischen Ökonomie und Ethik zu finden (vgl. hierzu die jeweiligen Definitionen auf der Unterseite über das Verhältnis von Ökologie, Ökonomie und Ethik).
Die Frage, ob der Begriff der Konsumentenethik ein Synonym für Wirtschaftsethik ist, kann verneint werden:
Neben der Konsumentenethik umfasst die Wirtschaftsethik (englisch: business ethics) auch die Unternehmensethik (englisch: corporate ethics) und das ethische Verhalten von öffentlichen Unternehmen, Verwaltungen und Staaten. Daher ist die Konsumentenethik ein Teilgebiet der Wirtschaftsethik.
» Hinweise zum Zitieren dieser Internetseite in wissenschaftlichen Arbeiten
Literaturangaben und Anmerkungen
-
Weniger gebräuchliche und übliche Synonyme für den Begriff „Konsumentenethik“ (englisch: consumer ethics) sind „Konsumethik“ und „Verbraucherethik“.
-
Höffe, Otfried (1992), Lexikon der Ethik, 4. Aufl., Verlag C.H. Beck, München, S. 61.
-
Ebenda, S. 62.
-
Homann, Karl/Blome-Drees, Franz: Unternehmensethik/Managementethik, in: Die Betriebswirtschaft, Jg. 55, Nr. 1/1995, S. 97.
-
Einen Handlungsbedarf im Naturschutz, Umweltschutz und Tierschutz greifen beispielsweise ökologisch ausgerichtete Verbraucherschutzverbände und Unternehmensinitiativen sowie Tierrechtsverbände auf.
-
Czerwonka, Christine/Schöpfe, Günter/Weckbach, Stefan (1976): Der aktive Konsument – Kommunikation und Kooperation, Schwartz-Verlag, Göttingen, S. 29.
-
Galbraith, John Kenneth (1986): Die moderne Industriegesellschaft, Verlagsgruppe Droemer Knaur, München, S. 223–237.
-
Friedrich, M. (1996): Offshore-Ölförderung, in: Greenpeace Magazin 5/96, Hamburg, S. 53.
-
Greenpeace Magazin 4/96, Hamburg, S. 32.
-
Ebenda, S. 32.
-
Laut Umweltmanagement-Daten von Greenpeace aus dem Jahr 1996, die auf neutralen Umweltschutz-Überprüfungen beruht haben sollen, enthielten die Öl-Bohrinseln in der Nordsee zusammen etwa 2,6 Millionen Tonnen Stahl, 184.000 Tonnen nicht rostender Stahl, 193.000 Tonnen Aluminium, 174.000 Tonnen Kupfer, 10.500 Tonnen Zink, 1.800 Tonnen Blei, 2.200 Tonnen schwach-radioaktive Substanzen, 400 Tonnen Industriegase und 20 Tonnen krebserregende Polychlorierte Biphenyle (PCB) (Quelle: Greenpeace Magazin 4/96, Hamburg, S. 34).
-
World Ocean Review 7 (2021): Lebensgarant Ozean – nachhaltig nutzen, wirksam schützen, Maribus, Hamburg, S. 12–13.