Probleme der Planwirtschaft und des Kommunismus in der DDR und Sowjetunion
Was bedeutet Planwirtschaft? Einfach erklärt: Welche Nachteile der Zentralverwaltungswirtschaft zeigten sich bei der Bewältigung der Umweltkrise? Welche Auswirkungen hatte diese Wirtschaftsordnung?
Definition und Merkmale
In einer Planwirtschaft (englisch: planned economy) wird die ungeplante Anarchie der gesellschaftlichen Produktion in der Marktwirtschaft durch eine planmäßig bewusste Organisation ersetzt.
Eine zentrale Planungsbehörde legt fest, welche Güter in welcher Menge und Qualität produziert und zu welchem Preis und in welcher Reihenfolge an Unternehmen und Konsumenten verteilt werden sollen.[1]
Der Begriff „Güter“ umfasst sowohl physisch-materielle Güter als auch immaterielle Güter wie Dienstleistungen, Konzepte und Rechte aller Art.
Durch die zentrale Planung erhält jeder Sektor und jedes Unternehmen der Volkswirtschaft genau den Anteil an der Gesamtarbeit, der aus der Sicht einer optimalen Güterversorgung notwendig ist.
Die Arbeitsanteile werden nicht mehr durch krisenreiche Anpassungen im Nachhinein ermittelt. Dahinter steht die Idee, dass durch bewusste Planung sogar bessere Arbeitsanteile festgelegt werden können.
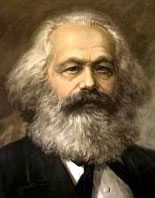
(1818–1883)
Die Planwirtschaft hat ihren Ursprung in den kommunistischen Theorien zur Überwindung des kapitalistischen Systems von Friedrich Engels, Karl Marx und Wladimir Iljitsch Lenin im 19. Jahrhundert.
Das Ziel der ökonomischen und politischen Lehren dieser drei Philosophen und Theoretiker ist die Verwirklichung einer herrschaftsfreien und klassenlosen Gesellschaft.
Diese Gesellschaft ist gekennzeichnet durch die weitestgehende Aufhebung des Privateigentums von Produktionsmitteln und deren Überführung in Staatseigentum, also in Kollektivvermögen der Gesellschaft.
Die Verstaatlichung verfolgt das Ziel, dass die Arbeitskraft der Arbeiterklasse (des Proletariats) nicht mehr durch die Kapitalistenklasse, also den Eigentümern der Produktionsmittel, ausgebeutet wird.
Im Sozialismus sollen negative wirtschaftliche Phänomene wie Arbeitslosigkeit, gesellschaftliche Klassenkonflikte, Konjunkturschwankungen oder Verteilungsungerechtigkeiten überwunden werden.
Unterschiede zur Marktwirtschaft
In einer Marktwirtschaft gibt es im Gegensatz zu einer Planwirtschaft keine zentrale Wirtschaftsplanung. Stattdessen erfolgt die Planung der einzelwirtschaftlichen Aktivitäten dezentral.
Konsumenten und Unternehmen können ihr wirtschaftliches Verhalten individuell und weitgehend in eigener Verantwortung planen. Dies hat folgende Auswirkungen:
- Unternehmen können frei entscheiden, welche Güter sie in welcher Menge und wie produzieren möchten.
- Konsumenten können frei entscheiden, welche Güter sie in welcher Menge erwerben möchten.
Die Feststellung des notwendigen Aufwands an Arbeit und Produktionsmitteln für eine aus kommunistischer Sicht optimale Güterversorgung der Volkswirtschaft erfolgt nicht planmäßig im Voraus.
Ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage stellt sich auf Märkten ein, wo sich die Preise für wirtschaftliche Güter eher zufällig im Verlauf eines anonym bleibenden Spiels mit vielen Versuchen und Irrtümern aller Marktteilnehmer bilden.
Der Wettbewerbs- und Preismechanismus des Marktes koordiniert über flexible Preise die Wirtschaftstätigkeiten und Wünsche der Marktteilnehmer und vermittelt Informationen über die relativen Knappheiten von Gütern.
Im Gegensatz dazu legt in einer Planwirtschaft der Staat die Preise fest und verteilt die Ressourcen Arbeit, Kapital, Güter und Boden an Unternehmen und Konsumenten.
Angestrebte Vorteile
In einer staatlich organisierten Planwirtschaft sollen die Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln und die zentrale Planung im Vergleich zu einer Marktwirtschaft folgende Vorteile mit sich bringen:
- Höhere Produktivität.
- Höherer ökonomischer Wohlstand.
- Gerechtere Güterverteilung.
Da alle Gesellschaftsmitglieder Eigentümer der Produktionsmittel sind, herrscht Gleichheit aller in Bezug auf die Stellung zu den Produktionsmitteln. Folglich soll es in der Planwirtschaft nach dieser Definition keine Ausbeutung der Menschen durch die Klasse der Vermögenden mehr geben.
Ein weiterer Vorteil der kommunistischen Gesellschaftsordnung und des sozialistischen Wirtschaftssystems soll die Überwindung der Entfremdung der Menschen von den Erzeugnissen ihrer Arbeit sein.
Diese Entfremdung ist nach dieser Auffassung weitgehend auf die Produktion für anonyme Märkte zurückzuführen, die im marktwirtschaftlichen System unvermeidbar ist.
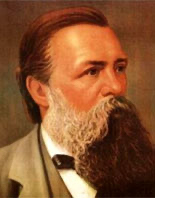
(1820–1895)
Darüber hinaus soll die zentrale Planwirtschaft im Kommunismus den im Vergleich zu einer Marktwirtschaft vorhandenen Zwang zum Gegeneinander der Menschen in ein Füreinander umwandeln.
Friedrich Engels beschrieb diesen Wandel als einen Übergang vom Kampf um das Einzeldasein zu einem Zustand der solidarischen Zusammenarbeit, in dem sich die einzelnen Gesellschaftsmitglieder selbst verwirklichen können.
Engels erklärte, dass dies der Zeitpunkt sei, an dem der Mensch endgültig aus dem Tierreich ausscheidet und in ein menschliches Dasein eintritt, wie folgt:
„Es ist der Sprung der Menschheit aus dem Reich der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit. [...] Erst von da an werden die Menschen ihre Geschichte mit vollem Bewusstsein selbst machen können“.[2]
Praktische Nachteile
Die sozialistische Planwirtschaft wies praktische Nachteile auf, und die prognostizierten Vorteile konnten aufgrund zahlreicher unüberwindbarer Probleme bis heute nicht realisiert werden.
Wo auch immer eine sozialistische Zentralverwaltungswirtschaft eingeführt wurde, zeigte sich ein deutlicher Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit und damit zwischen den versprochenen Vorteilen und den tatsächlichen Ergebnissen.
Die von Friedrich Engels skizzierte Vision einer neuen Qualität des menschlichen Zusammenlebens, die durch die Beseitigung der unkontrollierten, anonymen Warenproduktion und die Vergesellschaftung der Produktionsmittel in der Planwirtschaft erreicht werden sollte, ist bis heute nicht verwirklicht worden.[3]
Im Vergleich zur freien Marktwirtschaft führte die sozialistische Planwirtschaft und Wirtschaftsordnung nicht zu höherem Wohlstand und größeren Freiheitsrechten, sondern im Gegenteil.
Insbesondere im Bereich des Umweltschutzes oder Naturschutzes hat sich in der Praxis gezeigt, dass eine Planwirtschaft im Vergleich zu einer Marktwirtschaft zu schlechteren Ergebnissen führt.
Die Ursache für die größere Umweltzerstörung im Bereich von Luft, Boden und Wasser in einer Zentralverwaltungswirtschaft liegt im geringeren gesellschaftlichen Wohlstand, den diese hervorbringen kann.
Daher ist Umweltschutz ohne ein funktionierendes Wirtschaftssystem nicht möglich:
Letztlich haben die Bedürfnisse des täglichen Lebens und Knappheiten Vorrang und bestimmen maßgeblich das Handeln von Produktionsbetrieben, Konsumenten und der staatlichen Zentralverwaltung.
Umweltschutz ist mit Kosten verbunden, und daher gilt: Umweltschutz muss man sich leisten können.
In welchen Ländern gab und gibt es die Zentralverwaltungswirtschaft?
Planwirtschaften standen vor unüberwindbaren Herausforderungen und waren daher reformbedürftig, wie die Praxis der Zentralverwaltungswirtschaft gezeigt hat.
In welchen Ländern wurde die Planwirtschaft praktiziert?
Ab Ende der 1980er Jahre wandelten die meisten kommunistisch regierten Länder ihre sozialistische Planwirtschaft mit Staatseigentum in eine Marktwirtschaft mit vorwiegend Privateigentum um.
Zu diesen Ländern gehörten China und die ehemalige Sowjetunion, die aus der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR, englisch: USSR) und den Ländern des früheren kommunistischen Ostblocks bestand.
Ab 1956 bestand die Sowjetunion aus den folgenden 15 Unionsrepubliken (Sowjetrepubliken), die eine sozialistische Planwirtschaft praktizierten:
Armenien, Aserbaidschan, Estland, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Lettland, Litauen, Moldau, Russland, Tadschikistan, Turkmenistan, Ukraine, Usbekistan und Weißrussland (Belarus).
Bis zum Fall des Eisernen Vorhangs in Europa im Jahr 1989 gehörten Bulgarien, die Deutsche Demokratische Republik (DDR), Polen, Rumänien, die Tschechoslowakei (ČSSR) und Ungarn zu den Ostblock-Staaten.
Diese Länder folgten dem Modell der Planwirtschaft und der Theorie einer Zentralverwaltungswirtschaft nach Karl Marx und Friedrich Engels, mit der das kapitalistische System überwunden werden sollte.
In welchen Ländern gibt es noch die Planwirtschaft? Im 21. Jahrhundert praktizieren nur noch wenige Länder die Planwirtschaft. Elemente einer Zentralverwaltungswirtschaft sind in unterschiedlichem Ausmaß in der Wirtschaftslenkung von China, Kuba, Nordkorea, Venezuela und Vietnam zu finden.
Sonderfall der Umwandlung: die DDR
Ein Sonderfall der schnellen Transformation einer Planwirtschaft in eine Marktwirtschaft ereignete sich 1990 in der ehemaligen DDR. Diese Transformation, in der Literatur bekannt als „Super-Big-Bang“, war einzigartig.[4]
Der Super-Big-Bang konnte in Mitteldeutschland nur aufgrund der politischen Vereinigung der DDR mit der West-BRD stattfinden, die die Umwandlung des Wirtschaftssystems begleitete.
Im Zuge dieser Umwandlung wurden die langjährig erprobten und bewährten Finanz-, Geld-, Rechts-, Steuer- und Verwaltungssysteme der alten Bundesrepublik Deutschland übernommen.
Der Ansatz des Super-Big-Bangs schuf einen stabilen rechtlichen und institutionellen Rahmen, der für Investoren unerlässlich ist, um langfristige Projekte realisieren zu können.[5]
Zudem erhielt die DDR zu Beginn der Umwandlung ihrer Planwirtschaft eine schnelle, beträchtliche Anschubfinanzierung durch öffentliche Stellen der West-BRD im Rahmen der „Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion“.
Dadurch flossen 64 Milliarden DM im Jahr 1990 und 113 Milliarden DM im Jahr 1991 in die DDR.[6]
Diese beträchtliche finanzielle Unterstützung wurde in erster Linie durch das „Gesetz zur Privatisierung und Reorganisation des volkseigenen Vermögens“ (Treuhandgesetz) vom 1. Juli 1990 ermöglicht und refinanziert.
Um die Privatisierung staatlicher Betriebe zu organisieren, gründete der Ministerrat der DDR bereits vor dem Mauerfall am 1. März 1990 die Treuhandanstalt (kurz: Treuhand) in Berlin.
Das Treuhandgesetz verlieh der Treuhand die Verfügungsgewalt über alle volkseigenen Betriebe. Ihre Aufgabe bestand darin, diese Betriebe zu sanieren und in rentable, private Unternehmen umzuwandeln.
Betriebe, bei denen eine Sanierung nicht möglich war, wurden stillgelegt und ihr Anlagevermögen wurde veräußert.
Wenn man die Auflösung der Treuhand zum Jahresende 1994 als wichtigen Meilenstein interpretiert, so dauerte die Umwandlung der DDR-Planwirtschaft in eine soziale Marktwirtschaft etwa 4,5 Jahre.
Die Voraussetzungen für eine derart schnelle Transformation einer Planwirtschaft in eine Marktwirtschaft, wie sie in der DDR stattfand, waren in anderen sozialistischen Ländern nicht gegeben, wodurch die Umwandlung dort länger dauerte.
Der Systemübergang in der DDR erfolgte in einem großen Sprung (Big-Bang-Ansatz) anstelle eines stufenweisen, allmählichen Übergangs (Gradualismus-Ansatz) und hatte folgende Vorteile:
- Es gab keine Konkurrenz von Planwirtschaft und Marktwirtschaft in der Übergangsphase.
- Die Produktivität der Güterproduktion stieg schnell.
- Die Lebenssituation der Menschen verbesserte sich deutlich.
- Es gab keine großen sozialen und politischen Spannungen aufgrund von hoher Arbeitslosigkeit.
Die zu erwartenden Auswirkungen und Nachteile einer derartigen Schocktherapie für die Gesellschaft und die Wirtschaft der DDR blieben somit aus.
Allerdings ist festzuhalten, dass die Treuhandanstalt bei ihrer Auflösung Ende 1994 entgegen allen Erwartungen einen negativen Saldo ihrer Bilanz von 205 Milliarden DM auswies.[7]
Warum ist der Sozialismus gescheitert?
Das Scheitern des Sozialismus lässt sich auf Mängel und Konstruktionsfehler innerhalb der sozialistischen Wirtschaftsordnung zurückführen.
Diese basiert auf einer unrealistischen Vorstellung über das Planungsproblem und das Lenkungsproblem in Industriegesellschaften, die wiederum auf ein unrealistisches Menschenbild zurückzuführen ist.[8]
Planungsprobleme und Lenkungsprobleme
Der Anspruch, die volkswirtschaftlichen Prozesse bewusst und zielgerecht zu planen, führt zu Planungsproblemen und Lenkungsproblemen. Außerdem führt er zur Schaffung einer zentralen, staatlichen Planungsbehörde, in der ökonomische und politische Macht konzentriert sind.
Der großen Mehrheit der Gesellschaftsmitglieder verbleiben dadurch nur minimale Entscheidungsspielräume.
Im Gegensatz zur Marktwirtschaft sind in der Planwirtschaft des Sozialismus Vorgänge wie der freie Handel, die Festlegung von Preisen, die Nutzung von Produktionsfaktoren und deren koordinierter Einsatz an staatliche Genehmigungen und zentrale Kontrollen gebunden.
Die Nachteile und Probleme der zentralen Planung und Koordination ergeben sich aus der Unüberschaubarkeit der volkswirtschaftlichen Prozesse.
In einer komplexen Industriegesellschaft übersteigt die Zahl der zu planenden Güter die Millionengrenze.
Zudem fließen in einem arbeitsteilig organisierten Industriesystem Tausende von Daten in jeden Produktionsprozess ein. Folglich müsste eine zentrale Planungsstelle Milliarden solcher Daten korrekt einplanen. Das Versagen der Planwirtschaft ist somit vorprogrammiert.
Daher reicht es nicht aus, wie Friedrich Engels glaubte, nur zu wissen „wie viel Arbeit jeder Gebrauchsgegenstand zu seiner Herstellung bedarf“, um anschließend den Volkswirtschaftsplan aufzustellen.[9]
Vielmehr muss bekannt sein, welcher Bedarf mit Hilfe welcher Güter in welchen Arten und Mengen und mit welchem Verfahren zu produzieren ist.
Darüber hinaus muss festgelegt werden, wie und an wen die produzierten Güter verteilt werden. Dafür sind präzise Informationen über folgende Punkte erforderlich:
- Die relativen Knappheiten aller Güterarten, um über deren Verwendung zu entscheiden.
- Die Differenzen zwischen tatsächlicher Verfügbarkeit und tatsächlichem Bedarf einzelner Güter.
Andernfalls ist eine rationale Planung und Lenkung der Wirtschaftsprozesse nicht möglich.
Wird dabei auf den Markt als Informationssystem verzichtet, in dem über den Preisbildungsmechanismus relative Knappheiten von Gütern einfach und effizient angezeigt werden, verbleibt als Möglichkeit nur die Zentralisierung der Informationen in Verbindung mit einer zentralen Koordination der wirtschaftlichen Entscheidungen.[10]
Die Planung zukünftiger Wirtschaftsabläufe in der Planwirtschaft bedeutet jedoch nichts anderes als die Programmierung zukünftiger Verhaltensweisen von Millionen von Menschen.
Die Umsetzung des zentral festgelegten Plans hat zwangsläufig mit Hilfe konkreter Regeln und Verhaltensvorschriften wie Auflagen und Kennziffern zu erfolgen.
Dabei muss der Handlungsspielraum der einzelnen Produzenten im Kommunismus minimal gehalten werden, um die Erreichung des angestrebten Sollzustands nicht zu gefährden.
Unrealistisches Menschenbild
Ein weiterer Grund für das weltweite Scheitern der sozialistischen Planwirtschaft und die Nichtrealisierung ihrer prognostizierten Vorteile liegt in ihrem unrealistischen Menschenbild.
Der Nachteil der zentralen Programmierung der Verhaltensweisen in der Planwirtschaft führt zur Einengung persönlicher Freiräume und unterwirft die Einzelnen dem Willen der zentralen Leitung.
In einem solchen System wären Menschen erforderlich, die ihr Leben ausschließlich an den staatlichen Wirtschaftsplänen ausrichten, da diese die gesellschaftlichen Interessen widerspiegeln.
Der Einzelne darf in einer zentralistischen Planwirtschaft nur von sozialen Tugenden geleitet werden.
Besitzdenken, soziales Aufstiegsstreben, Egoismus, Neid, Bequemlichkeit oder gar Faulheit und andere bekannte menschliche Schwächen müssten den einzelnen Menschen fremd sein.
Die plankonforme Arbeit müsste zum wichtigsten Lebensbedürfnis aller Gesellschaftsmitglieder werden.
Allerdings lassen sich derart vollkommene Lebewesen in der bisherigen Geschichte der sozialistischen Wirtschaftsordnung und ihrer Planwirtschaft nicht nachweisen.
Wären alle Menschen reine Altruisten, deren Denken und Handeln durch Selbstlosigkeit, Uneigennützigkeit und Rücksicht auf andere gekennzeichnet sind, so wären Leistungsanreize überflüssig.
In einem solchen Szenario würden alle ohnehin das Richtige tun und sich genauso anstrengen, wie wenn die Vorteile und Früchte ihrer Arbeit nur ihnen allein zugute kämen.
Im Gegensatz zur christlichen Lehre geht der Kommunismus von einem Menschenbild des guten Menschen aus. Die Realität sieht jedoch anders aus, da die Mehrheit der Menschen zum Egoismus neigt.
Ein ökonomisches Wirtschaftssystem kann nur dann Erfolg haben, wenn es auf einem realistischen Menschenbild basiert.
Der Wunschtraum einer idealen Gesellschaft, wie er in der sozialistischen Planwirtschaft des Kommunismus zum Ausdruck kommt, ist daher von vornherein zum Scheitern verurteilt.
Unzufriedenheit der Bevölkerung
Die Praxis hat gezeigt, dass die Durchsetzung einer sozialistischen Planwirtschaft zu einer zunehmenden Unzufriedenheit in der Bevölkerung führte, und zwar aus mehreren Gründen.
In der sozialistischen Planwirtschaft fehlten Leistungsanreize, daher musste der Staat das Verhalten der Bevölkerung in der Güterproduktion zentral steuern und befehlen.
Zwang ist jedoch bekanntlich bei mangelnder Arbeitsmotivation ein ineffektives Mittel, um die Leistungsbereitschaft von Menschen dauerhaft zu steigern.
Darüber hinaus wurde die Güterversorgung aufgrund der Ineffizienz der Güterproduktion in der sozialistischen Planwirtschaft von weiten Teilen der Bevölkerung als unzureichend empfunden.
Dies lag nicht zuletzt daran, dass die Bevölkerung in den kommunistisch regierten Ländern nicht vollständig von Informationen aus den Massenmedien wie Fernsehen, Radio, Zeitungen und Zeitschriften oder von Besuchern aus den Industrieländern abgeschottet werden konnte.
Die Bevölkerung konnte die Verhältnisse in ihrer Zentralverwaltungswirtschaft mit denen in Ländern mit einer Marktwirtschaft vergleichen.
Die Vergleichsgrundlage bildeten folgende Kriterien:
- Umfang, Qualität und Vielfalt der Güterversorgung
- Grad der individuellen Bewegungs- und Entscheidungsfreiheit
- Möglichkeiten des Staates zur willkürlichen Diskriminierung und Unterdrückung von Bürgern
Dieser Vergleich der Marktwirtschaft mit der Planwirtschaft musste zwangsläufig Auswirkungen haben und große Unzufriedenheit in einer Bevölkerung mit sozialistischer Wirtschaftslenkung hervorrufen.
Daher mussten die Führer der sozialistischen Staaten Gewalt einsetzen, um politische Proteste der Bevölkerung zu unterdrücken.
Dies verstärkte jedoch die Unzufriedenheit der Bevölkerung und die desolate Wirtschaftslage zusätzlich.
Internationaler Machtkampf
Der internationale Machtkampf zwang die Führung der Kommunistischen Partei in China und der Sowjetunion dazu, ihre Planwirtschaften zu reformieren und marktwirtschaftliche Prinzipien zu integrieren.
Die wirtschaftliche Stärke eines Landes ist entscheidend dafür, welche militärische und politische Macht es auf internationaler Ebene ausüben kann.
Dieser Faktor war von Bedeutung für das im kommunistischen Manifest von Karl Marx und Friedrich Engels zum Ausdruck gebrachte Ziel des Sozialismus: „Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“.[11]
Nach der kommunistischen Ideologie soll sich der Sozialismus, der die Arbeiterklasse von der Knechtschaft durch die kapitalistische Klasse befreit, im Zuge einer Weltrevolution international durchsetzen.
Marx und Engels verdeutlichten dieses ehrgeizige Ziel in ihrem Kommunistischen Manifest wie folgt:
„Mit einem Wort, die Kommunisten unterstützen überall jede revolutionäre Bewegung gegen die bestehenden gesellschaftlichen und politischen Zustände“.[12]
Infolgedessen versuchten China und die Sowjetunion jahrzehntelang, ihre Macht auszuweiten, um die kommunistische Weltrevolution vorzubereiten und zu unterstützen.
Dies zeigte sich in einem kostspieligen Rüstungswettlauf mit den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und ihren westlichen NATO-Bündnispartnern während des Kalten Krieges im Ost-West-Konflikt.
In diesem Konflikt spielte die Sowjetunion eine führende Rolle im Militärbündnis des Warschauer Paktes.
Zu diesem Bündnis gehörten auch die sozialistischen Staaten des Ostblocks, darunter Bulgarien, die DDR, Polen, Rumänien, die Tschechoslowakei und Ungarn. Darüber hinaus waren China, Nordkorea und Nordvietnam als Beobachter beteiligt.
Zudem befand sich die Sowjetunion von Anfang der 1960er Jahre bis zu ihrer Auflösung 1991 in einem Spannungsfeld mit China. Beide Großmächte warfen sich gegenseitig imperialistische Interessen vor.
Die militärischen Spannungen zwischen beiden Riesenreichen, die durch eine 4.000 km lange gemeinsame Grenze getrennt waren, erreichten ihren vorläufigen Höhepunkt 1969 mit dem „Zwischenfall am Ussuri“.
Dieser militärische Konflikt am Grenzfluss Ussuri um die Insel Zhenbao Dao hätte beinahe zu einer größeren militärischen Auseinandersetzung zwischen China und der Sowjetunion geführt.
Der Konflikt mit China und die Mitgliedschaft der Sowjetunion im Warschauer Pakt, der sich im Kalten Krieg mit den Westmächten befand, führten zu erheblichen militärischen Kosten für die Sowjetunion.
Die immensen Militärkosten konnten mit einer Planwirtschaft nicht länger finanziert werden, was zu einer stetigen Verschlechterung der ohnehin prekären Versorgungslage der sowjetischen Bevölkerung führte.
Die Volksrepublik China hingegen sah sich mit einem drohenden Rückgang ihrer wirtschaftlichen Machtposition konfrontiert, da die vier asiatischen Tigerstaaten (Hongkong, Singapur, Südkorea, Taiwan) ein starkes Wirtschaftswachstum verzeichneten.
Seit den 1980er Jahren waren diese vier Volkswirtschaften Südostasiens dank ihrer Marktwirtschaft in der Wettbewerbsfähigkeit an die Industrieländer herangerückt.
Um dem drohenden Rückgang ihres Außenhandels entgegenzuwirken, sah sich die Volksrepublik China letztendlich gezwungen, ihre Planwirtschaft in Richtung Marktwirtschaft zu reformieren.
Fazit des Vergleichs der Wirtschaftssysteme
Die wirtschaftliche Entwicklung der Volksrepublik China, der Sowjetunion und der Staaten des Ostblocks (Bulgarien, DDR, Polen, Rumänien, Tschechoslowakei und Ungarn) nach der Transformation ihrer Planwirtschaften in Marktwirtschaften hat deutlich gezeigt:
Eine Marktwirtschaft ist im Vergleich zur Planwirtschaft wesentlich besser für die industrielle Massenproduktion geeignet und ermöglicht eine bessere Entfaltung der wirtschaftlichen Produktivkräfte eines Landes.
Aus diesem Grund haben die meisten ehemals kommunistisch regierten Länder ihre Zentralverwaltungswirtschaft in eine dezentral gelenkte Marktwirtschaft mit überwiegendem Privateigentum transformiert.
» Hinweise zum Zitieren dieser Internetseite in wissenschaftlichen Arbeiten
Literaturangaben
-
Woll, Artur (1984): Allgemeine Volkswirtschaftslehre, 8. Auflage, Franz Vahlen Verlag, München, S. 67.
-
Hamel, Hannelore (1989): Soziale Marktwirtschaft – Sozialistische Planwirtschaft, ein Vergleich Bundesrepublik Deutschland – DDR, Franz Vahlen Verlag, München, S. 17/19.
-
Ebenda, S. 21 f.
-
Gahlen, Bernhard/Hesse, Helmut/Ramser, Hans Jürgen (1992): Von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft – Eine Zwischenbilanz, Verlag J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, S. 10.
-
Sinn, Gerlinde/Sinn, Hans-Werner (1993): Kaltstart – Volkswirtschaftliche Aspekte der Deutschen Vereinigung, 3. Auflage, Deutscher Taschenbuch Verlag (dtv) im C. H. Beck Verlag, München, S. 29.
-
Ebenda, S. 30.
-
Deutsche Bundesbank: Monatsbericht März 1997, Frankfurt am Main, S. 22.
-
Hamel, Hannelore (1989): Soziale Marktwirtschaft – Sozialistische Planwirtschaft, ein Vergleich Bundesrepublik Deutschland – DDR, Franz Vahlen Verlag, München, S. 21 f.
-
Matis, Herbert (1992): Der Weg aus der Knechtschaft – Probleme des Übergangs von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft, Ueberreuter-Verlag, Wien, S. 54.
-
Ebenda, S. 55.
-
Marx, Karl/Engels, Friedrich (1848): Manifest der Kommunistischen Partei, 1. Auflage, London, S. 23.
-
Ebenda, S. 23.