Die Wirtschaftsordnung der freien, sozialen und ökosozialen Marktwirtschaft
Was versteht man unter der Wirtschaftsordnung der freien, sozialen und ökosozialen Marktwirtschaft? Was ist Marktversagen? Welche Bedeutung haben externe Effekte für die Bewältigung der Umweltkrise?
Definition, Merkmale, Modelle
In den meisten Industrieländern hat sich die Marktwirtschaft als dominantes Wirtschaftssystem etabliert. Dieses System basiert auf liberalen Prinzipien und dem Streben nach maximaler individueller wirtschaftlicher Freiheit.
In einer Marktwirtschaft handeln eigenverantwortliche Wirtschaftseinheiten, geleitet von ihrem Eigeninteresse, und schaffen so ein Angebot und eine Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen.
Anbieter und Nachfrager treffen auf Märkten zusammen, wo sich unter Wettbewerbsbedingungen ein Gleichgewichtspreis einstellt. Dieser Preis bringt Angebot und Nachfrage in Einklang.
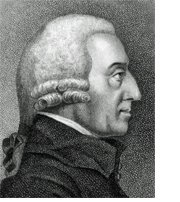
Der Ansatz dieser Wirtschaftsordnung geht zurück auf Adam Smith (1723–1790), einen schottischen Aufklärer, Moralphilosoph und Ökonom.
Adam Smith gilt neben neben den ihm nachfolgenden britischen Ökonomen Thomas Malthus (1766–1834), John Stuart Mill (1806–1873), David Ricardo (1772–1823) und dem französischen Ökonomen Jean-Baptiste Say (1767–1832) als Begründer der Ökonomie als eigenständige wissenschaftliche Disziplin.
Sein 1776 erschienenes Werk „Der Wohlstand der Nationen“ begründete die klassische Nationalökonomie und legte damit den Grundstein für die moderne Nationalökonomie.[1]
Adam Smith ging davon aus, dass alle Marktteilnehmer, selbst wenn sie nur egoistische wirtschaftliche Ziele verfolgen, durch Selbstorganisation zum größtmöglichen Allgemeinwohl beitragen.
Diese Annahme stützte er auf das Prinzip der „Unsichtbaren Hand“ des Marktes:
„Jeder einzelne bemüht sich darum, sein Kapital so einzusetzen, dass es den größten Ertrag erbringt. Im Allgemeinen wird er weder bestrebt sein, das öffentliche Wohl zu fördern, noch wird er wissen, inwieweit er es fördert. Er interessiert sich nur für seine eigene Sicherheit und seinen eigenen Gewinn. Und gerade dabei wird er von einer unsichtbaren Hand geleitet, ein Ziel zu fördern, das er von sich aus nicht anstrebt. Indem er seine eigenen Interessen verfolgt, fördert er das Wohl der Gesellschaft häufig wirksamer, als wenn er es direkt beabsichtigt hätte“.[2]
In einem Marktwirtschaftssystem koordinieren flexible Preise die Wirtschaftstätigkeiten und Wünsche der Marktteilnehmer und vermitteln Informationen über die relativen Knappheiten von Gütern.
Die Aussicht auf Gewinne und Verluste motiviert die Wirtschaftsteilnehmer, effiziente Entscheidungen zu treffen und innovativen Anstrengungen zu unternehmen.
Unterschieden werden können drei Modelle, die aufeinander aufbauen:
- die freie Marktwirtschaft
- die soziale Marktwirtschaft
- die ökologisch-soziale Marktwirtschaft
Das klassische Modell der freien Marktwirtschaft geht davon aus, dass ein Mindestmaß an staatlichen Eingriffen für das Funktionieren einer Marktwirtschaft unerlässlich ist.
Das Modell der sozialen Marktwirtschaft hält darüber hinaus weitere staatliche Eingriffe für notwendig, um einen sozialen Ausgleich innerhalb der Wirtschaftsordnung zu gewährleisten.
Das Modell der ökologisch-sozialen Marktwirtschaft erfordert zusätzlich zum sozialen Ausgleich weitere staatliche Eingriffe, um freier Naturgüter und die Interessen zukünftiger Generationen zu schützen.
Folglich wird von der freien bis zur ökologisch-sozialen Marktwirtschaft die Handlungsfreiheit aller Wirtschaftsteilnehmer durch zunehmende staatliche Regulierung eingeschränkt.
Marktwirtschaftsformen im Vergleich
Die drei aufeinander aufbauenden Marktwirtschaftsformen – die freie, die soziale und die ökologisch-soziale Marktwirtschaft – werden im Folgenden verglichen.
Die freie Marktwirtschaft
Das klassische Modell der freien Marktwirtschaft, wie es Adam Smith beschrieb, besagt, dass das Angebot an Gütern und Dienstleistungen sowie die Preisfestsetzung allein durch Angebot und Nachfrage auf freien Märkten bestimmt werden.
In einer freien Marktwirtschaft erfolgt die Planung und Koordination der Wirtschaftsprozesse dezentral. Angebot und Nachfrage steuern somit allein die Produktion und den Konsum von knappen Gütern.
Im Gegensatz zu einer Planwirtschaft, in der der Staat die meisten Bereiche der Wirtschaft regelt und zentral festlegt, welche Güter zu welchen Preisen angeboten und an wen verteilt werden, soll sich der Staat im klassischen Modell der freien Marktwirtschaft weitestgehend aus der Wirtschaft heraushalten.
Dennoch hat der Staat in der freien Marktwirtschaft die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Vormachtstellung und das Monopol Einzelner oder Weniger die Produktivität der Vielen nicht behindern.
Gerade Konzerne und große Unternehmen können eine marktbeherrschende Stellung erlangen und damit den freien Wettbewerb der Marktwirtschaft gefährden.
Ohne staatliche Wettbewerbskontrolle besteht die Gefahr, dass sich wirtschaftliche Macht konzentriert und Monopole oder Kartelle entstehen, die sich unnatürliche Wettbewerbsvorteile verschaffen möchten.
Damit eine Marktwirtschaft funktionieren kann, müssen Rahmenbedingungen festgelegt werden, um Leistungen bereitzustellen, in denen Marktversagen vorliegt. Dazu gehören:
- Das Recht auf Eigentum, insbesondere das Recht auf Privateigentum an Produktionsmitteln.[3]
- Ein Rechtssystem, das die Vertragserfüllung durchsetzt und Einzelne vor Unterdrückung schützt.
- Eine Wettbewerbskontrolle, die freien Marktzugang gewährleistet und Kartelle (Mengenbeschränkungen und Preisabsprachen mehrerer Unternehmen) und Monopole (ein Unternehmen kontrolliert für ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung den Markt) verhindert.[4]
- Freiheitsrechte im Bereich freier Arbeitsplatzwahl und Berufswahl, Gewerbefreiheit, Handelsfreiheit, Konsumfreiheit, Investitionsfreiheit, Produktionsfreiheit, Vertragsfreiheit und Wettbewerbsfreiheit.[5]
- Gewährleistung der inneren und äußeren Sicherheit durch die Bereitstellung eines Polizeiwesens und einer militärischen Landesverteidigung.
- Schaffung eines stabilen Währungssystems zur Verhinderung einer ineffizienten Tauschwirtschaft.[6]
- Schaffung funktionierender Kredit- und Finanzmärkte, um Wirtschaftswachstum zu gewährleisten.[7]
- Bereitstellung öffentlicher Güter des Allgemeinwohls, die Einzelne nicht selbst finanzieren können, wie beispielsweise in der Bildung, im Verkehr und bei Innovationen mit hohem Investitionsrisiko.
Im klassischen Modell der freien Marktwirtschaft beschränkt sich die Rolle des Staates auf die eines Minimalstaates oder Nachtwächterstaates, was jedoch auch soziale Nachteile mit sich bringt:
- Fehlende Absicherung von Arbeitslosigkeit
- Fehlende Absicherung des Existenzminimums
- Fehlende Bereitstellung eines staatlichen Gesundheitssystems
- Fehlende Arbeitsschutzregelungen
Das Modell der sozialen Marktwirtschaft soll die sozialen Nachteile der freien Marktwirtschaft beheben.
Die soziale Marktwirtschaft
Das Modell der sozialen Marktwirtschaft, das sich im deutschsprachigen Raum auf die Ideen von Alfred Müller-Armack (1901–1978), Walter Eucken (1891–1950) und Ludwig Erhard (1897–1977) zurückführen lässt, geht davon aus, dass im Bereich sozialer Gerechtigkeit ein Marktversagen vorliegt.[8]
Um dieses Marktversagen zu beheben, schlägt das Modell der sozialen Marktwirtschaft vor, dass der Staat das Handeln der Wirtschaftsteilnehmer bei größtmöglicher Freiheit so lenken sollte, dass soziale Gerechtigkeit im Gesamtsystem gewährleistet ist.
Im Gegensatz zum Minimalstaat im klassischen Modell der freien Marktwirtschaft, das mit der Kritik an den sozialen Nachteilen behaftet ist, tritt der Staat in der sozialen Marktwirtschaft als Sozialstaat auf.
In dieser Rolle soll er soziale Unterschiede in der Bevölkerung bis zu einem gewissen Grad ausgleichen, um Chancengleichheit und Teilhabe an gesellschaftlichen Entwicklungen für alle zu ermöglichen.
Das Wirtschaftsmodell der sozialen Marktwirtschaft verfolgt einen Mittelweg zwischen Plan- und Marktwirtschaft. Sie soll Gegner und Befürworter der Marktwirtschaft über den sozialen Aspekt vereinen.
Im Vergleich zur freien Marktwirtschaft weist die soziale Marktwirtschaft Nachteile und Vorteile auf.
Zu den Nachteilen zählen beispielsweise:
- Höhere Arbeitskosten aufgrund kürzerer Arbeitszeiten, Kündigungsschutzrechten, Mitbestimmungsrechten und Sozialversicherungskosten der Arbeitnehmer.
- Höhere Betriebskosten infolge von Vorschriften zum Arbeitsschutz und zur Betriebssicherheit.
- Höhere Abgaben und Steuern zur Finanzierung der staatlichen Kontrolle und Umsetzung sozialer Standards mit Transferzahlungen zur Umverteilung und Begrenzung von Ungleichheiten.
- Risiko, dass Unternehmen ihre Produktion in Länder mit geringeren sozialen Standards verlegen.
Zu den Vorteilen zählen beispielsweise:
- Höhere soziale Sicherheit.
- Eine bessere Infrastruktur.
- Ein höheres Ausbildungsniveau.
- Höherer Lebensstandard.
- Mehr politische Stabilität.
- Höhere Motivation und Produktivität der Mitarbeiter.
Das Modell der sozialen Marktwirtschaft wurde in zahlreichen Industrieländern umgesetzt, darunter Dänemark, die Bundesrepublik Deutschland, Finnland, Norwegen, Österreich, die Schweiz und Schweden.
Allerdings berücksichtigt dieses Modell nicht die durch die Wirtschaftstätigkeit verursachten Naturschäden, den Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen und die vernachlässigten Interessen künftiger Generationen im Bereich des Naturschutzes.
Das nachfolgende Modell der ökologisch-sozialen Marktwirtschaft soll diese Probleme lösen.
Die ökologisch-soziale Marktwirtschaft
Das Modell der ökologisch-sozialen oder ökosozialen Marktwirtschaft erweitert die soziale Marktwirtschaft um eine ökologische Dimension und das Konzept einer nachhaltigen Entwicklung.
Es zielt darauf ab, Ökonomie, Ökologie und Soziales gleichermaßen zu berücksichtigen. Neben Geboten und Verboten sollen auch marktwirtschaftliche Anreize und Instrumente zum Schutz der Natur eingesetzt werden.
Allerdings ist es fraglich, ob es im Interesse aktuell lebender Menschen und zukünftiger Generationen ist, bestimmte Verschmutzungen von Boden, Luft und Wasser mit Giftstoffen durch Naturschutz-Abgaben zu regeln, anstatt sie gänzlich zu verbieten.
Die Ursprünge des Modells der ökologisch-sozialen Marktwirtschaft reichen bis in die 1970er und 1980er Jahre zurück, als bedeutende ökologische Studien wie „Die Grenzen des Wachstums“ (1972), „Global 2000“ (1980) und der „Brundtland-Bericht“ (1987) veröffentlicht wurden.
Diese Studien betonten die begrenzte Verfügbarkeit von Naturgütern und warnten vor der drohenden Zerstörung der Lebensgrundlagen der Menschen durch Verschmutzung und wirtschaftliche Ausbeutung der Natur.
Das ökosoziale Modell erkennt an, dass Marktversagen nicht nur im Bereich der sozialen Gerechtigkeit, sondern auch im Bereich des Naturschutzes und der intergenerativen Gerechtigkeit auftreten kann.
Ein Marktversagen im Bereich intergenerativer Gerechtigkeit zeigt sich beispielsweise darin, dass Naturschäden verursacht werden, die die Interessen zukünftiger Generationen nicht berücksichtigen, wie bei der Abholzung tropischer Regenwälder oder der Verschmutzung der Weltmeere mit Plastikmüll.
Die Verursachung solcher langfristigen Naturschädigungen wird dadurch begünstigt, dass sich der Wert von Naturgütern, wie beispielsweise die Schönheit einer Landschaft oder die genetische Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren, nicht objektiv mit Preisen bewerten lässt.
Ein Marktversagen im Bereich des Naturschutzes zeigt sich beispielsweise in folgenden Sachverhalten:
- Der Verbrauch nicht erneuerbarer Rohstoffe wie Metalle oder fossile Brennstoffe erhöht das Bruttoinlandsprodukt (BIP) einer Volkswirtschaft, obwohl es dabei zu einem Substanzverlust kommt.
- Für die Kosten der zukünftigen Wiederherstellung und Schadstoffreinigung von geschädigtem Boden, Luft und Wasser müssten Rückstellungen gebildet werden, die das Bruttoinlandsprodukt verringern. Diese Kosten werden jedoch nicht in dessen Berechnung einbezogen.
Diese Beispiele verdeutlichen die begrenzte Aussagekraft eines Bruttoinlandsprodukts, in dessen Berechnung nur die mit Preisen bewertbaren Güter enthalten sind.
Darüber hinaus ist das Bruttoinlandsprodukt auch in anderen Bereichen wenig aussagekräftig. So wirken sich folgende Vorgänge in einer Volkswirtschaft ebenfalls positiv auf das Bruttoinlandsprodukt aus:
- Ausgaben für Medikamente und Behandlungen bei Ärzten und in Krankenhäusern.
- Ausgaben für Sicherheitstechnik zum Schutz von Häusern vor Einbrüchen.
- Ausgaben für Militär und Polizei zur Verteidigung der inneren und äußeren Sicherheit.
- Ausgaben für Anwälte und Gerichte aufgrund hoher Scheidungsraten oder Eheberatungskosten.
Dagegen werden folgende Faktoren nicht im Bruttoinlandsprodukt erfasst:
- Zufriedenheit, Gesundheit, Lebensqualität, Lebenserwartung und Freizeit der Bevölkerung.
- Qualität der Erziehung in Bezug auf Allgemeinbildung, Tugenden und Werte.
- Engagement für Ehrenämter, Hausarbeit und Freiwilligenarbeit.
- Geringe Verteilungsunterschiede bei Einkommen und Vermögen in der Bevölkerung.
Was versteht man unter einem Marktversagen?
Die drei Modelle der Marktwirtschaft gehen davon aus, dass staatliche Eingriffe in das Wirtschaftsgeschehen aufgrund von Marktversagen zwingend notwendig sein können.
Marktversagen tritt auf, wenn der Preismechanismus des Marktes die optimale Bereitstellung und/oder Verteilung von Gütern und Ressourcen nicht gewährleisten kann.
In der Wirtschaftswissenschaft (Ökonomie) existieren unterschiedliche Auffassungen darüber, was unter Marktversagen zu verstehen ist und in welchen Situationen es in einer Marktwirtschaft auftritt.
Die klassische Nationalökonomie hält ein Mindestmaß staatlicher Eingriffe in die Wirtschaft für unverzichtbar (siehe Beispiele bei freier Marktwirtschaft weiter oben).
Vertreter dieser Schule, wie beispielsweise Adam Smith (1723–1790), John Stuart Mill (1806–1873), David Ricardo (1772–1823) oder Jean-Baptiste Say (1767–1832), sind dem Liberalismus zuzuordnen.
In der modernen Nationalökonomie wird die Rolle des Staates zunehmend reduziert. Einige befürworten eine minimale staatliche Präsenz, die sich auf die Sicherung grundlegender Freiheiten beschränkt, während andere für einen vollständigen Rückzug des Staates aus der Wirtschaft plädieren.
Vertreter dieser Ansicht, wie beispielsweise David D. Friedman (geb. 1945), Ayn Rand (1905–1982), Murray Newton Rothbard (1926–1995) oder Ludwig von Mises (1881–1973), gehören dem Libertarismus an.
Libertäre Ökonomen bezweifeln, dass staatliche Eingriffe Marktversagen nachhaltig beseitigen können, ohne dass sich der Staat gleichzeitig ausdehnt und die Effizienz seiner Leistungen leidet.
Ein Kompromiss für unterschiedliche Meinungen darüber, wann und in welchem Umfang staatliche Regelungen in das Wirtschaftsgeschehen eingreifen sollten, könnte folgender allgemeiner Grundsatz sein:
Staatliche Eingriffe sind stets dort erforderlich, wo Vernünftiges nicht von selbst zustande kommt.
Begriffserklärung und Ursachen externer Effekte
In der Volkswirtschaftslehre werden bei Marktversagen sogenannte externe Effekte hervorgerufen, die sowohl negative als auch positive Auswirkungen haben können.
Externe Effekte entstehen, wenn Konsum- oder Produktionsaktivitäten von Wirtschaftsteilnehmern Auswirkungen auf die Konsum- und Produktionsmöglichkeiten anderer Wirtschaftsteilnehmer oder auf Dritte wie Pflanzen, Tieren oder die Natur insgesamt haben, ohne dass der Preismechanismus des Marktes diese berücksichtigt.[9]
Negative externe Effekte entstehen, wenn die Kosten von unbeteiligten Benachteiligten zu tragen sind und nicht von den Verursachern, die sich der von ihnen verursachten Kosten nicht zwangsläufig bewusst sein müssen.[10]
Mit anderen Worten: Bei negativen externen Effekten müssen die Verursacher von Nachteilen an die Benachteiligten keinen Ausgleich leisten und die Geschädigten erhalten keine Entschädigung.
Positive externe Effekte entstehen, wenn Gewinne oder der Nutzen nicht den Verursachern, sondern unbeteiligten Begünstigten zugute kommen, die sich dieser Vorteile nicht bewusst sein müssen.[9]
Mit anderen Worten: Bei positiven externen Effekten erhalten die Verursacher von Vorteilen von den Begünstigten keine Entschädigung, und die Nutznießer müssen keine Gegenleistung erbringen.
Negative externe Effekte nennt man externe Kosten und positive externe Effekte auch externer Nutzen.
Beispiele für allokative Marktmängel und Fehlallokation
In bestimmten Bereichen einer Marktwirtschaft kann es aufgrund von Marktversagen zu ineffizienten Ressourcenverteilungen kommen, die als allokative Marktmängel bezeichnet werden.
Ein effizient funktionierender Markt würde Funktionen einer Ordnungspolitik erfüllen, wie beispielsweise:
- Kontrolle von Monopolen.
- Sicherung des Wettbewerbs.
- Bereitstellung eines stabilen Geldsystems.
- Gewährleistung innerer und äußerer Sicherheit.
Darüber hinaus würde ein effizient funktionierender Markt folgende Funktionen erfüllen:
- Förderung sozialer Gerechtigkeit innerhalb eines Landes und zwischen verschiedenen Ländern.
- Berücksichtigung der Interessen künftiger Generationen, also intergenerativer Gerechtigkeit.
- Berücksichtigung der Interessen anderer Lebewesen wie Pflanzen, Pilze und Tiere.
- Verhinderung einer Fehlnutzung freier Naturgüter (Boden, Luft, Wasser und Ökosysteme).
Der Begriff „allokative Marktmängel“ oder „Fehlallokation“ bezeichnet die ineffiziente oder fehlende Zuweisung von Gütern an einzelne Wirtschaftsteilnehmer oder Produktionsprozesse über den Marktmechanismus.
In einer Planwirtschaft bestimmt eine zentrale Planungsbehörde die Verteilung (Allokation) von Gütern, während in einer Marktwirtschaft der Preismechanismus von Märkten, auf denen sich die Preise von Gütern nach Angebot und Nachfrage einstellen, die Verteilung bestimmt.
Exkurs: Umweltethische Einstufung der Wirtschaftsordnungen
Aus umweltethischer Sicht lassen sich die verschiedenen Wirtschaftsordnungen wie folgt bewerten:
Die freie Marktwirtschaft berücksichtigt weder soziale noch ökologische Aspekte und kann daher als „egoistische Umweltethik“ bezeichnet werden, die sich entweder auf einzelne Individuen oder eine begrenzte Zahl von Rechteinhabern beschränkt.
Die soziale Marktwirtschaft hingegen berücksichtigt soziale Interessen, um den gesellschaftlichen
Frieden zu sichern, und ist daher umweltethisch dem Anthropozentrismus zuzuordnen.
Die ökosoziale Marktwirtschaft berücksichtigt die Interessen leidensfähiger Tiere (wie im Pathozentrismus), Pflanzen (wie im Biozentrismus) und der unbelebten Natur (wie im Holismus) nur, wenn es den Menschen zugute kommt, und ist daher anthropozentrisch motiviert.
Wie die soziale Marktwirtschaft berücksichtigt auch die ökosoziale Marktwirtschaft nichtmenschliche Interessen nur dann, wenn sie den Menschen zugute kommen, und nicht, weil Tieren, Pflanzen und der Natur eigenständige Rechte eingeräumt werden.
Die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung in der ökosozialen Marktwirtschaft zielt jedoch darauf ab, das Überleben der Menschheit und damit die Interessen künftiger Generationen zu sichern.
Daher entspricht eine ökosoziale Marktwirtschaft nicht nur dem Grundmodell einer anthropozentrischen Umweltethik, sondern auch einer anthropozentrischen Umweltethik im weiteren Sinne (siehe auch Diskussion umweltethischer Ansätze).
» Hinweise zum Zitieren dieser Internetseite in wissenschaftlichen Arbeiten
Literaturangaben und Anmerkungen
-
Samuelson, Paul Anthony (1981): Volkswirtschaftslehre, Band 1, 7. Auflage, Bund-Verlag, Köln, S. 63. Der Titel des 1776 erschienenen Werkes „Der Wohlstand der Nationen“ lautete in der originalen englischen Version „The Wealth of Nations“.
-
Ebenda, S. 61, deutschsprachige Übersetzung aus dem Werk „Wealth of Nations“ von Adam Smith aus dem Jahr 1776.
-
Privateigentum gehört zu den Voraussetzungen jeder Wettbewerbsordnung, da erst aus dem Eigentum die Motivation für den ökonomischen und verantwortlichen Umgang mit knappen Ressourcen entsteht. Dies betonte der deutsche Ökonom Walter Eucken (1891–1950) in seinem Werk „Grundsätze der Wirtschaftspolitik“ [5. Auflage, 1975, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, S. 271]. Eucken war ein Vordenker der sozialen Marktwirtschaft und Mitbegründer der Freiburger Schule des Ordoliberalismus.
Im Gegensatz zum Kollektiveigentum fördert Privateigentum die Eigeninitiative des Einzelnen. Allerdings sind Eigentumsrechte nicht immer unbedingt erforderlich. Auch Mietverträge, Pachtverträge oder Leasingverträge können den Anreiz für einen ökonomischen und verantwortlichen Umgang mit knappen Ressourcen aus Eigeninteresse schaffen.
-
Im klassischen Modell der freien Marktwirtschaft bedeutet staatliche Wettbewerbskontrolle nicht, dass zeitlich beschränkte Monopole nicht entstehen können. Dies ist beispielsweise bei Innovationen der Fall, die den jeweiligen Erfindern oder Unternehmen vorübergehend einen Marktvorteil verschaffen.
Kennzeichen der freien Marktwirtschaft ist die im Gegensatz zur Planwirtschaft vorhandene ständige und höhere Motivation zur Entwicklung neuer und besserer Produkte oder effizienterer Produktionsverfahren.
Ein Marktvorsprung durch innovative Güterangebote, die mit zusätzlichen Gewinnen verbunden sind, ist im Sinne der Wettbewerbsfreiheit unproblematisch. Dies gilt jedoch nur, wenn Mitbewerber nicht dauerhaft vom Markt ausgeschlossen werden und Monopole durch Innovationen zeitlich beschränkt sind, bis die Konkurrenz den Vorsprung aufgeholt hat.
In diesem Zusammenhang steht die staatliche Garantie eines Patentschutzes dem nicht entgegen. Einerseits können nach Ablauf des Patentschutzes und der Veröffentlichung der Patentschrift nachahmende Güterangebote auf den Markt drängen, wie beispielsweise in der Pharmazie durch Generika. Andererseits kann der Patentschutz die Konkurrenz zur Entwicklung innovativer Güter motivieren, die das durch den Patentschutz entstandene Monopol ausgleichen oder sogar vom Markt verdrängen.
-
Erst Freiheitsrechte ermöglichen es den einzelnen Wirtschaftsteilnehmern, eigene Ziele zu verfolgen, was zu einer größeren Leistungsmotivation führt und insgesamt die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft erhöht. Darauf wies der deutsche Politikwissenschaftler und Volkswirt Frank Pilz (1949–2017) in seinem Werk „Das System der sozialen Marktwirtschaft – Konzeption, Wirklichkeit, Perspektiven“ hin (1974, 1. Auflage, Ernst Reinhardt Verlag, München, S. 37).
In einem Marktwirtschaftssystem müssen Wirtschaftsteilnehmer die Freiheit haben, nach Belieben Arbeitsverträge, Kaufverträge, Mietverträge, Pachtverträge und Dienstleistungsverträge abzuschließen, um an Märkten agieren zu können.
Im Falle von Vertragsverletzungen sollten Schadensersatzansprüche bis hin zu strafrechtlichen Bestimmungen, insbesondere bei arglistiger Täuschung, greifen. Darüber hinaus muss die Einhaltung von Verträgen rechtlich durchsetzbar sein.
Das Prinzip der Vertragshaftung erhöht die Effizienz der Volkswirtschaft, da unverantwortliches wirtschaftliches Verhalten zum Ausschluss aus dem Wirtschaftsprozess führen kann.
-
Ohne eine stabile Währung würde die Geldwirtschaft sowohl in der Marktwirtschaft als auch in der Planwirtschaft durch eine ineffiziente Tauschwirtschaft ersetzt werden. Wenn Wirtschaftssubjekte kein Vertrauen in die Werterhaltung von Geld haben, werden sie dessen Verwendung einschränken und Forderungen, die auf Geld lauten, nicht mehr akzeptieren.
-
Funktionierende Finanz- und Kreditmärkte sind von entscheidender Bedeutung, da sie die zeitlich versetzten Spar- und Investitionsentscheidungen von Haushalten, Unternehmen und dem Staat zeitlich koordinieren.
In einer dezentralisierten freien Marktwirtschaft ermöglichen erst Finanz- und Kreditmärkte die Beschaffung großer Kapitalmengen und die Risikostreuung von Investitionen auf eine Vielzahl von Anlegern.
-
Der Begriff „soziale Marktwirtschaft“ wurde nicht von Ludwig Erhard und Walter Eucken geprägt, sondern von Alfred Müller-Armack, der ihn erstmals in seinem Werk „Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft“ verwendete (1947, 1. Auflage, Verlag für Wirtschaft und Sozialpolitik, Hamburg, S. 59).
-
Humboldt-Wirtschafts-Lexikon (1992), Humboldt-Taschenbuchverlag, München, S. 130.
-
Ebenda, S. 130.